
Zurück zur Übersichtsseite
DZG-Gespräch
Wie Daten Leben retten können
Ein Gespräch zwischen Prof. Dr. Martin Hrabě de Angelis, Vorstand des Deutschen Zentrums für Diabetesforschung, und Rudolf Hauke, Vorsitzender des Patientenbeirat Krebsforschung des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) und des Deutschen Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK)

Herr Professor Hrabě de Angelis, die Digitalisierung von Gesundheitsdaten eröffnet der Forschung ganz neue Chancen. Damit es gelingt, diesen wachsenden Datenschatz im Interesse aller zu nutzen, müssen die Positionen und Werte der Patient:innen zur Spende ihrer Gesundheitsdaten einbezogen werden. Warum sind Daten so wertvoll für die Forschung und welchen Mehrwert haben sie?
Prof. Dr. Martin Hrabě de Angelis
Forschungsergebnisse beruhen grundsätzlich auf Daten. Wenn man einer Hypothese nachgeht, etwa der Annahme, dass Demenzerkrankung und Diabetes etwas miteinander zu tun haben, braucht man Daten, um auf Grundlage von echten Erkenntnissen und Wissen, also evidenzbasiert, eine Aussage zu treffen.
Bei Diabetes Typ 2 hat man zum Beispiel in den letzten Jahren herausgefunden, dass es Subtypen gibt, die unterschiedlich sind und verschieden behandelt werden müssen. Diese Erkenntnis beruht auf großen Studien mit vielen tausend Menschen, deren Daten ausgewertet wurden. Das Ziel ist es, mithilfe solcher großen Datenmengen personalisierte, also auf den einzelnen Patienten zugeschnittene Aussagen treffen zu können.
Bei Diabetes Typ 2 hat man zum Beispiel in den letzten Jahren herausgefunden, dass es Subtypen gibt, die unterschiedlich sind und verschieden behandelt werden müssen. Diese Erkenntnis beruht auf großen Studien mit vielen tausend Menschen, deren Daten ausgewertet wurden. Das Ziel ist es, mithilfe solcher großen Datenmengen personalisierte, also auf den einzelnen Patienten zugeschnittene Aussagen treffen zu können.
Herr Hauke, wie sehen Sie als Patientenvertreter in der Krebsforschung den Einsatz von Patientendaten in der Forschung?
Rudolf Hauke
Lassen Sie mich mit einem Zitat der Bundesforschungsministerin Stark-Watzinger beginnen, sie hat gesagt: „Die beste Chance im Kampf gegen Krebs ist eine exzellente Forschung.“ Da sind wir uns alle einig. Aber ohne ausreichende Daten ist die Krebsforschung im Blindflug unterwegs. Daten sind sowohl für die Forschung als auch für die Versorgung von absolut essenzieller Bedeutung und retten Leben.

„Ohne ausreichende Daten ist die Krebsforschung im Blindflug unterwegs."
Doch ich denke, da gibt es noch Hindernisse zu überwinden. Herr Prof. Hrabě de Angelis hat die Entwicklung der personalisierten Medizin und die damit verbundenen großen Chancen für uns, die Patientinnen und Patienten, angesprochen. Aufgrund der aktuellen Rechtslage und der momentanen Praxis beim Datenschutz ist die Nutzung von Daten in Deutschland zurzeit aber nur eingeschränkt möglich.
Sie sprachen eben an, Herr Prof. Hrabě de Angelis, dass die Gesundheitsdaten zum Teil aus großen Studien stammen. Was sind weitere Datenquellen?
Prof. Dr. Martin Hrabě de Angelis
Die Daten kommen aus verschiedenen Quellen. Zunächst einmal aus klinischen Studien, die eine konkrete Frage verfolgen, etwa wie gut ein bestimmtes Medikament bei einer speziellen Patientengruppe wirkt. Darüber hinaus kommen die Daten aus Studien, die untersuchen, wie häufig Krankheiten in einer Bevölkerung vorkommen, wie sie verteilt sind und welche Risiko- und Schutzfaktoren es gibt. Beispiele für solche bevölkerungsbezogenen Datenerhebungen sind die NAKO Gesundheitsstudie in Deutschland, die als Langzeitstudie über 20 bis 30 Jahre die Daten von 200.000 Bürgerinnen und Bürgern erhebt oder die UK Biobank in Großbritannien, mit denen wir viel zusammenarbeiten.
Eine ganz andere Art von Daten sind direkte Patientinnen- und Patientendaten, etwa von Krankenkassen. Wobei sich die von den Krankenkassen erhobenen Daten an Abrechnungssystemen orientieren und nicht an Forschungsfragen. Das müssen wir berücksichtigen, wenn wir mit diesen Daten arbeiten, damit sie uns nicht auf eine falsche Fährte führen.
Außerdem muss man zwischen klinischen und präklinischen Daten unterscheiden. Klinische Daten befassen sich mit Menschen, während die präklinischen Daten häufig auf Zellkultursystemen, künstlichen Organmodellen oder Tiermodellen beruhen.
Eine ganz andere Art von Daten sind direkte Patientinnen- und Patientendaten, etwa von Krankenkassen. Wobei sich die von den Krankenkassen erhobenen Daten an Abrechnungssystemen orientieren und nicht an Forschungsfragen. Das müssen wir berücksichtigen, wenn wir mit diesen Daten arbeiten, damit sie uns nicht auf eine falsche Fährte führen.
Außerdem muss man zwischen klinischen und präklinischen Daten unterscheiden. Klinische Daten befassen sich mit Menschen, während die präklinischen Daten häufig auf Zellkultursystemen, künstlichen Organmodellen oder Tiermodellen beruhen.
„Es gibt erste, gut funktionierende Pilotprojekte.“

Diese unterschiedlichen Daten sinnvoll zu verknüpfen, ist dann der nächste Schritt. Dafür gibt es konkrete Pläne und erste, gut funktionierende Pilotprojekte. Die Technologien sind alle vorhanden. Doch der Zugang zu den Daten ist momentan aus unterschiedlichen Gründen noch erschwert. Vor allem ist er durch den Datenschutz beziehungswiese die deutsche Auslegung der Datenschutzgrundverordnung beeinträchtigt. Wir sind da ein Stück weit von dem entfernt, was wir für den Forschungsfortschritt und zum Wohle der Patientinnen und Patienten machen könnten.
Wie werden die Daten der Patientinnen und Patienten geschützt?
Prof. Dr. Martin Hrabě de Angelis
Deutschland ist im Umgang mit Daten extrem vorsichtig. Es gibt Datenschutzbeauftragte, die darüber wachen, dass die Datenschutzgrundverordnung eingehalten wird. So arbeiten wir nur mit pseudonymisierten Daten. Dabei ersetzt eine Treuhandstelle die persönlichen Angaben der Patienten durch ein Pseudonym, sodass es den Forschenden nicht möglich ist, anhand der vorliegenden Informationen eine Person zu identifizieren.

„Eine Treuhandstelle ersetzt die persönlichen Daten durch ein Pseudonym.“
Herr Hauke, wie steht der Patientenbeirat des DKFZ zu den Themen Datennutzung und Datenschutz?
Rudolf Hauke
„Datenschützer arbeiten für die Gesunden – und Kranke wollen die Analyse von Daten.“ Das ist ein Stück weit wahr. Als Patientenbeirat des DKFZ haben wir uns schon mehrmals mit den Themen Datennutzung und Datenschutz befasst. Es ist selbstverständlich, dass der Schutz personenbezogener Daten gewährleistet sein muss, dass Daten sicher sein müssen, um einen unkontrollierten Zugriff zu verhindern. Das ist allgemeiner Konsens, sowohl bei gesunden Menschen als auch bei Patientinnen und Patienten. Und die geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen dafür stehen bereit. Was aber noch viel zu wenig beachtet wird, ist, dass die Nutzung von Daten lebensrettend ist.
Lassen Sie mich dazu etwas Persönliches, Emotionales einbringen: Ich bin 2001 zum ersten Mal an Krebs erkrankt. Inzwischen habe ich so ziemlich alle Therapien hinter mir, Stammzelltherapie, CAR-T-Zelltherapie, und war an vier Unikliniken in Behandlung. Wenn ich am Tropf hänge, ist es mir völlig egal, ob meine Daten bis zum Letzten geschützt sind. Ich wünsche mir nur, dass sie der Forschung zur Verfügung stehen.
Lassen Sie mich dazu etwas Persönliches, Emotionales einbringen: Ich bin 2001 zum ersten Mal an Krebs erkrankt. Inzwischen habe ich so ziemlich alle Therapien hinter mir, Stammzelltherapie, CAR-T-Zelltherapie, und war an vier Unikliniken in Behandlung. Wenn ich am Tropf hänge, ist es mir völlig egal, ob meine Daten bis zum Letzten geschützt sind. Ich wünsche mir nur, dass sie der Forschung zur Verfügung stehen.

„Eine Opt-out-Lösung würde zu besseren und schnelleren Ergebnissen in der Forschung führen."
In Deutschland erfolgt eine Datenspende nur mit der ausdrücklichen Einwilligung der jeweiligen Person. Das hat lange Einwilligungskaskaden zur Folge. Eine Opt-out-Lösung für Gesundheitsdaten – also die grundsätzliche Erlaubnis sie zu nutzen, wenn dem nicht aktiv widersprochen wird –, würde zu besseren und schnelleren Ergebnissen in der Forschung führen. Daran wird im Bundesgesundheitsministerium gearbeitet, zumindest was die Gesundheitsdaten betrifft. Außerdem ist ein Europäischer Gesundheitsdatenraum geplant, auf dessen Regeln sich das Bundesgesundheitsministerium bereits einstellen will. Das müssen auch wir Patientenvertreter unterstützen, wo es geht.
Insgesamt kann ich sagen, dass wir Patientinnen und Patienten der Datennutzung überwiegend positiv gegenüberstehen.
Insgesamt kann ich sagen, dass wir Patientinnen und Patienten der Datennutzung überwiegend positiv gegenüberstehen.
Prof. Dr. Martin Hrabě de Angelis
Das ist ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, Herr Hauke. Das geplante deutsche Gesundheitsdatennutzungsgesetz und der Europäische Gesundheitsdatenraum sind die Chance, die Datennutzung in Deutschland auf einen internationalen Standard zu heben. Wobei man sagen muss, dass Deutschland dabei ist, sich zu organisieren. Es gibt bereits Aktivitäten, mit denen wir uns über Bundesländer und Metropolregionen hinweg organisieren, um Daten einzubringen und nutzbar zu machen. Aber es besteht noch ein großer Handlungsbedarf. Das ist kein einfacher Prozess, weil wir in einem föderalen und nicht in einem zentralistischen Land leben.

„Deutschland muss versuchen, vorne mit dabei zu sein und zu gestalten.“
Gemäß der FAIR-Prinzipien sollen Daten „Findable, Accessible, Interoperable und Re-usable“ sein, also auffindbar, zugänglich, miteinander vereinbar und, ganz wichtig, reproduzierbar. Nur wenn sie reproduzierbar sind, also noch einmal „hergestellt“ werden können, sind sie qualitativ so gut, dass wir darauf aufbauend eine Prävention oder Therapie entwickeln können. All diese wichtigen Aspekte werden durch die europäische Bewegung jetzt mit Nachdruck angeschoben. Da muss Deutschland versuchen, nicht hinterherzulaufen, sondern vorne mit dabei zu sein und zu gestalten. Denn eine gute Datenbasis, zusammen mit künstlicher Intelligenz wird viele neue Möglichkeiten für die Diagnose und Therapie eröffnen.
Rudolf Hauke
Ich kann die Initiativen zur Nutzbarmachung von Gesundheitsdaten nur unterstützen und es bewegt sich bereits etwas in diese Richtung. Dafür möchte ich ein Beispiel bringen: Das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen, kurz NCT, wird von derzeit zwei auf sechs Standorte erweitert. An diesem Konzept haben wir als Patientenvertreterinnen und -vertreter drei Jahre erfolgreich mitgearbeitet. Über diese Struktur werden Daten zur Verfügung stehen, die die Forschung erleichtern. Denn anders als in den USA sind in Deutschland viele Unikliniken zurzeit sehr lokal ausgerichtet. Über das NCT wollen wir das ändern und die Zusammenarbeit stärken.
Prof. Dr. Martin Hrabě de Angelis
Ich möchte noch weitere Beispiele anführen, die zeigen, wo wir bereits von der Datennutzung und künstlicher Intelligenz profitieren: Retinopathien sind eine Folgeerkrankung bei schweren Verläufen von Diabetes. Diese Erkrankung der Augen-Netzhaut kann man mithilfe KI-unterstützter Methoden wesentlich besser diagnostizieren. Außerdem haben wir KI-basierte Systeme entwickelt, die anhand eines EKGs klarere Aussagen treffen können, als Personen, die tausende EKG gesehen haben. Diese Entwicklungen passieren überall auf der Welt. Es ist eine Riesenchance und wir stehen noch ganz am Anfang.
„Es ist eine Riesenchance und wir stehen noch ganz am Anfang.“

Das Erheben von Daten in unserem deutschen Gesundheitssystem ist extrem kostspielig. Wir sollten, wie die skandinavischen Länder, unsere Gesundheitsdaten darum als „Schatz der Solidargemeinschaft" verstehen und daraus auch die Verantwortung ableiten, dass sowohl Patienten als auch gesunde Menschen ihre Daten spenden. Denn wir brauchen auch die Daten von gesunden Personen, um den Abgleich zu den Erkrankten durchzuführen. Das ist, glaube ich, die Schwierigkeit: Wie überzeugen wir diejenigen, die vielleicht im Moment noch gar nicht vor schweren, lebensbedrohlichen Gesundheitsproblemen stehen, ihre Daten zu geben, um anderen Menschen zu helfen.
Vielleicht hilft da eine Zahl: 50 Prozent aller Menschen erkranken im Laufe ihres Lebens an Krebs oder Diabetes. Also alle die jetzt denken, ich bin gesund und möchte meine Spende nicht geben, werden mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann von der Datenspende profitieren, oder?
Prof. Dr. Martin Hrabě de Angelis
Genau deswegen will man ja auch Richtung Opt-out – und das ist auch der richtige Weg. Die Datenhoheit liegt damit immer noch in den Händen eines jeden Einzelnen. Denn wer seine Daten nicht zur Verfügung stellen möchte, kann diese Opt-out-Option wählen, kann sich also gegen die Nutzung seiner Daten aussprechen. Dieses Vorgehen würde vieles leichter machen und es uns zum Beispiel auch ermöglichen, an internationalen Studien teilzunehmen, die aufgrund unserer langen Genehmigungsverfahren derzeit oft ohne uns stattfinden.
Wenn wir vom Schatz der Solidargemeinschaft sprechen, ist es in Deutschland neben dem Datenschutz wahrscheinlich auch ein Problem, wie die Daten erhoben und gespeichert werden, sodass sie dann auch tatsächlich kompatibel und zugänglich sind?
Prof. Dr. Martin Hrabě de Angelis
Richtig, aber ich kann Ihnen ein positives Beispiel nennen: In den Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung machen sich die Forschenden bereits zu Beginn einer Studie darüber Gedanken, in welchem Format Daten erhoben werden. Außerdem haben wir uns untereinander auf einen minimalen Datensatz geeinigt, der in allen Studien erhoben wird, sei es in der Krebsforschung, Lungenforschung, Infektionsforschung, bei Diabetes, Alzheimer und Demenz oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dabei folgen wir internationalen Standards, den bereits angesprochenen FAIR-Kriterien, um sicherzustellen, dass die Daten später verwendet werden können. Wie gesagt, die technischen Lösungen sind vorhanden. Das Problem liegt nur in der Umsetzung, in der Bereitschaft aller zu sagen: Wir setzen auf den internationalen Standard und dadurch werden unsere Daten untereinander operabel und kompatibel.

„In den DZG folgen wir internationalen Standards bei der Datenerhebung.“
Rudolf Hauke
Ich denke, dass da in Deutschland insgesamt noch ein kultureller Wandel stattfinden muss. Vielleicht noch ein Hinweis, da ich 16 Jahre Vorstand einer Krankenkasse war: Wir sollten auch nicht unterschätzen, was in unserer Solidargemeinschaft bei den einzelnen Krankenkassen für Datenschätze liegen. Nicht nur Abrechnungsdaten, sondern auch Behandlungsdaten. Aber auch da ist es heute so, dass man nicht alles verwenden und zusammenführen darf.
Ein Punkt wäre mir noch wichtig zu erwähnen, der nicht alleine mit Daten zu tun hat. Für uns Patientinnen und Patienten liegt der Vorteil der Teilnahme an einer Studie, in der Daten erhoben und beforscht wurden, darin, frühzeitig Zugang zu innovativen Behandlungen und Verfahren zu haben, die noch nicht zugelassen sind und daher nicht allgemein angewendet werden. Uns Betroffenen können diese Therapien möglicherweise sehr, sehr gut helfen.
Ein Punkt wäre mir noch wichtig zu erwähnen, der nicht alleine mit Daten zu tun hat. Für uns Patientinnen und Patienten liegt der Vorteil der Teilnahme an einer Studie, in der Daten erhoben und beforscht wurden, darin, frühzeitig Zugang zu innovativen Behandlungen und Verfahren zu haben, die noch nicht zugelassen sind und daher nicht allgemein angewendet werden. Uns Betroffenen können diese Therapien möglicherweise sehr, sehr gut helfen.
Prof. Dr. Martin Hrabě de Angelis
Im Gesundheitsbereich werden sich Prävention und Therapie in den nächsten zehn bis 20 Jahren wesentlich verbessern, davon bin ich fest überzeugt. Dazu tragen die Digitalisierung der Daten, die computergestützten Systeme, also Machine Learning und künstliche Intelligenz, entscheidend bei. Ich kann mir vorstellen, dass man in 20 Jahren, ein bisschen lächelnd auf 2023 zurückschaut, nach dem Motto: Sie haben ihr Bestes gegeben, doch Therapien ohne Nebenwirkungen waren ohne unsere Instrumente damals einfach nicht möglich. Das ist Zukunftsmusik, doch es ist die Vision, die mich antreibt, weiter zu forschen, mit Leuten zu reden, Interviews zu geben und nicht müde zu werden, über das Potenzial von Gesundheitsdaten zu sprechen.
Und – das geht stellvertretend an Sie, Herr Hauke – für uns ist es sehr wertvoll, dass wir die Patientenvertreterinnen und -vertreter immer dabeihaben. Sie eröffnen uns nochmal einen anderen Blick, der uns bei unserer täglichen Arbeit in der Forschung fehlt.
Und – das geht stellvertretend an Sie, Herr Hauke – für uns ist es sehr wertvoll, dass wir die Patientenvertreterinnen und -vertreter immer dabeihaben. Sie eröffnen uns nochmal einen anderen Blick, der uns bei unserer täglichen Arbeit in der Forschung fehlt.
Herr Professor Hrabě de Angelis, Herr Hauke, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.
Helga Rohra, Co-Vorsitzende des DZNE-Patientenbeirats
Mehr erfahren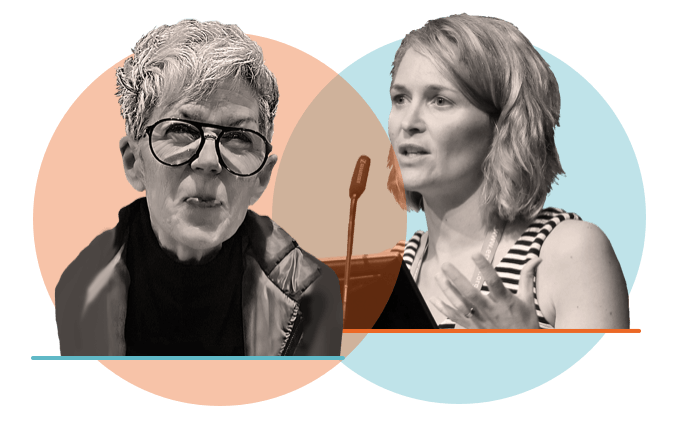

Zurück zur Übersichtsseite
Klinische Studien
Klinische Studien sind in der medizinischen Forschung unverzichtbar, um Erkrankungen besser vorzubeugen, sie schneller zu erkennen und gezielter zu behandeln. Patient:innen, die an einer klinische Studie teilnehmen, leisten damit einen wertvollen Beitrag zur Gesundheitsforschung, haben Zugang zu neuen Behandlungsansätzen und werden intensiv betreut.
Patient:innenbeteiligung
In der Gesundheitsforschung findet gerade ein Umdenken statt: Zunehmend wird erkannt, dass alle davon profitieren, wenn sich Patient:innen aktiv am Forschungsprozess beteiligen. In den DZG gibt es hierfür unterschiedliche Möglichkeiten.








